Kolumne nach NLS-Massencrash: Langstreckensport, wir müssen reden
Heiko Stritzke macht sich Sorgen über das immer höhere Risiko der Fahrer in Langstreckenrennen - Die Kultur dahinter zu ändern, wird immer schwerer
(Motorsport-Total.com) - Liebe Freunde des Langstreckensports,

© VLN
Der Massencrash beim NLS-6h-Rennen: Nur das Symptom eines tieferen Problems Zoom
man möge diese Kolumne bitte nicht als direkte Reaktion auf den Massenunfall von GT3-Fahrzeugen im Hatzenbach bei NLS4 verstehen. Es ist nur das Symptom einer bedenklichen Entwicklung. Denn diese eine Szene fasst komplett zusammen, wohin sich der Langstreckensport seit ungefähr einem Jahrzehnt entwickelt. Und die Veranstalter sehen tatenlos zu oder unterstützen die Gangart sogar noch.
Es wäre ein Leichtes, jetzt auf die Fahrer einzudreschen, was in den sozialen Medien auch bereits geschehen ist. Wer die Fahrer dort kritisiert, wird meist von anderen mit dem Argument mundtot gemacht, wie man denn als Couch-Potato diese Situation einschätzen könnte.
Dennoch lässt sich nicht von der Hand weisen, dass wir in jüngerer Zeit eine Häufung haarsträubender Szenen in Langstreckenrennen sehen. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit hier einmal eine Liste dramatischster Situationen aus den vergangenen drei Jahren, bei denen man angesichts der verbliebenen Restzeit im Rennen über die vorherrschende Aggressivität nur mit dem Kopf schütteln kann:
- Der Gülden-Terting-Crash beim 24h-Qualifikationsrennen 2021
- Der Vanthoor-Brudercrash beim 24h-Rennen 2022
- Unfälle von Pechito Lopez (2022) und Pipo Derani (2024) in Sebring
- Der Unfall rund um den Dacia beim 24h-Rennen 2023
- Vier Startunfälle in der WEC von Fuji 2023 bis Imola 2024
- Überrundungskollision beim IMSA-Finale 2023, die einen Titelkandidaten eliminiert
- Der Horrorcrash von Earl Bamber bei den 6 Stunden von Spa 2024
- Der Four-Wide beim 24h-Rennen 2024 mit 21 Stunden auf der Uhr
- Robert Kubicas Rammstoß gegen Dries Vanthoor bei 300 km/h in Le Mans
- Die Kollision zweier Porsche 963 in Sao Paulo in der ersten Rennstunde
- Der jüngste SP9-Massencrash bei einsetzendem Regen
Bitte Twitter-/X-Embeds erlauben, um die Situationen im Laufe des Artikels im Video zu sehen
Bezüglich der WEC-Startcrashs äußerte sich Peugeot-Werksfahrer Paul di Resta bereits sehr gereizt: "Jedes Mal endet der Start heute in einem Demolition Derby und man wird gleich zurückgeworfen. Die Fahrstandards sind wirklich schockierend und die Konsequenzen nicht groß genug." Di Resta wurde sowohl in Katar als auch in Imola beim Start über den Haufen gefahren.
Und auch, was wir bei NLS4 gesehen haben, lässt sich nur als "krass" bezeichnen. Ich hatte selbst einmal in meinem Leben das zweifelhafte Vergnügen, mit Slicks im Regen auf der Nürburgring-Nordschleife zu fahren. Mehr als gefühltes Schrittempo geht dabei nicht. Bei NLS4 sind manche Fahrzeuge mit dreistelligen Geschwindigkeiten abgeflogen.
Hinter der Bergab-Rechts war eine klare "Kante" auf der Fahrbahn zu erkennen, ab der die Strecke überflutet war. Eigentlich blieb bei diesem Anblick nichts anderes, als sofort die Bremsen reinzuhauen - gerade, wenn ABS an Bord ist.
Dennoch wurde in diesem Bereich von einigen Fahrern noch hochbeschleunigt, was sich dann in der anschließenden Kurve rächte. Selbst der routinierte Frank Stippler ließ sich von Bastian Buus provozieren, noch zu schnell in die Kurve zu fahren. Er verzögerte deutlich mehr als der Porsche-Junior, war aber war für die Bedingungen eben noch immer zu schnell.
Genau hier zeigt sich das Problem, wenn selbst Routiniers sich dazu verleiten lassen, um am vorderen Fahrzeug dran zu bleiben. Die Bewertung von Langstreckenfahrern erfolgt nämlich längst nicht mehr anhand klassischer Langstrecken-Kriterien. Die alten Hasen müssen sich wie Stippler anpassen, wenn sie nicht hinten runterfallen wollen.
"Endurance"-Faktoren zählen nicht mehr
Ein guter Langstreckenfahrer war einmal jemand, der ein Auto souverän und materialschonend, aber trotzdem in einem angemessenen Tempo bei jedem Wetter über die Distanz brachte. Wenn er auf eine Nordschleifenrunde fünf Sekunden langsamer war, machte das nicht zu viel aus. Vielleicht konnte man sich damit sogar über die Distanz einen oder zwei Boxenstopps sparen.
Das liegt daran, dass der Langstreckensport einmal über eine Matrix aus mehreren Faktoren entschieden wurde: Zuverlässigkeit, Reifenverschleiß und Spritverbrauch, Abstimmung des Fahrzeugs auf die jeweiligen Bedingungen, und Grundspeed des Autos.
Die Performance der einzelnen Fahrer spielte eine untergeordnete Rolle. So konnten ein Bob Wollek oder Strietzel Stuck noch im Alter von jenseits der 50 Jahre noch Werksfahrerverträge ergattern. Routine bei immer noch vorzeigbarem Grundspeed zählte mehr als jugendliche Risikobereitschaft und die Fähigkeit, drei oder vier Zehntel schneller zu fahren.
Doch im 21. Jahrhundert wurden nach und nach alle Faktoren ausgeblendet. Die Einführung der GT3-Klasse war dabei ein Wendepunkt: Autos werden seitdem nicht mehr gebaut, um eine möglichst hohe Performance innerhalb eines Reglements zu erzielen, sondern eine vorgegebene Performance in einem möglichst breiten Fenster zu erreichen. Damit wurden alle klassischen Endurance-Faktoren eliminiert.
Weil die Komponenten nicht mehr der Maximalbelastung ausgesetzt sind, können sie in ihrer Laufzeit ausgedehnt werden, was wiederum zu einer enormen Zuverlässigkeit der Fahrzeuge geführt hat. "Früher schieden 70 Prozent der Fahrzeuge durch technische Defekte und 30 Prozent durch Unfälle aus. Heute ist das Verhältnis eher fünf zu 95 Prozent", sagt mir ein Teamchef.
Ein anderer bekannter Teamchef ergänzt, gerade im Hinblick auf die 24 Stunden von Spa: "Früher wurde dieses Rennen mit fünf Runden Vorsprung gewonnen. Heute reden wir von fünf Sekunden." Deshalb erleben wir jetzt erst Videos wie den Wutausbruch von Stippler über einen Überrundeten, der sich über die Regeln nicht im Klaren ist.
GT3-Fahrzeuge haben heute Revisionsintervalle von mehr als 20.000 Kilometern für wichtige Komponenten. Die Zuverlässigkeit ist gar kein Thema mehr, wenn es um den Rennsieg geht, sondern nur noch ein Negativfaktor: Geht etwas kaputt, ist der Sieg auf der Stelle abgeschrieben. Selbst ein Verlust von drei Minuten ist aus eigener Kraft nicht mehr aufzuholen.
Gleichzeitig wurden die Fahrzeuge in allen Punkten angeglichen: Pace, Boxenstoppzeiten, Stintlängen - es gibt keinen Unterschied mehr. Die Zeiten, in denen ein BMW M3 einen deutlich stärkeren Porsche Turbo schlagen konnte, weil dieser im Rennen sechs Boxenstopps mehr einlegen musste, sind lange vorbei.
Auch die Reifen, einst ein sehr wichtiger Punkt in der angesprochenen Endurance-Matrix, sind in der Regel vereinheitlicht. Der Nürburgring ist mittlerweile zusammen mit der Super GT die große Ausnahme. Hier sind noch mehrere Hersteller erlaubt, in allen gängigen Rennserien ist dieses Unterscheidungsmerkmal ebenfalls weggefallen.
Der Druck ist groß wie nie
So hat sich das Bild mittlerweile komplett verschoben. Langstreckenrennen werden heute zu 97 Prozent über den reinen Grundspeed gewonnen und zu drei Prozent durch Glück. In vielen Serien wird mittels Safety-Car-Phasen zusätzlich mitten im Rennen die Uhr auf null zurückgedreht.
Da die Autos gleichschnell sind, liegt der Fokus nun auf der "Race Execution" - und den Fahrern. Plötzlich zählt die letzte Zehntel. Doch gleichzeitig wird es den Fahrern immer schwieriger gemacht, noch einen großen Unterschied zu machen, da die elektronischen Fahrhilfen den Speed künstlich angleichen. Ein heroisches Gefühl für den Gasfuß im Regen ist viel weniger wert als früher.
Um auf sich aufmerksam zu machen, sind mittlerweile immer spektakulärere Aktionen nötig. Wenn sie gutgehen, ist man der große Held - man denke etwa an David Pittards Außenbahn-Manöver im Streckenabschnitt Schwedenkreuz. Doch der Grat vom Hero zur Zero ist schmal.
Gerade für junge Fahrer ist es schwierig, wenn sie sich für Werkscockpits empfehlen wollen. Ein hoher Grundspeed ist Mindestvoraussetzung, ein Abheben von der Masse geht nur über spektakuläre Manöver. Und diejenigen, die ein Cockpit sicher haben, müssen ihren Platz immer und immer wieder rechtfertigen.
Zweikampfstärke und der Grundspeed bei Trockenheit waren einst im Langstreckensport unwichtig. Mittlerweile gehören sie zu den Hauptfaktoren bei der Fahrerauswahl.
Fahrer wie Walter Röhrl oder auch Ken Miles im Film "Le Mans 66 - Gegen jede Chance" (Ford v Ferrari) zeichneten sich durch ihr einmaliges Gefühl für die Mechanik eines Autos aus. Wie viel Drehzahl verkraftet der Motor? Wie hoch kann ich mit dem Ladedruck gehen? Wie viel Randstein verkraftet mein Fahrwerk über die Distanz?
Alle diese Faktoren sind ausgeschaltet. Drehzahl und Ladedruck sind vorgegeben, gefahren wird 24 Stunden am Limit. "In den 2010er-Jahren hat sich die Competition gnadenlos verschärft", sagt mir ein routinierter Fahrer. "Entweder man gast voll mit an, oder man ist raus. So einfach geht das."
Gröbste Fahrlässigkeit wird kaum bestraft
Und die Veranstalter? Die schauen sich das an und halten sich zurück. Schließlich produzieren die superengen Rennen mit spektakulären Zweikämpfen die Bilder, die sich vermarkten lassen: Knallhartes Rad-an-Rad-Racing, hin und wieder mal ein Unfall, der glimpflich ausgeht. Und genau das ist fatal.
Earl Bamber erhielt für den schweren Fehler in Spa eine Startplatzstrafe für Le Mans - ausgerechnet bei jenem Rennen, wo es auf die Startposition immer noch nicht ankommt, weil sich gut überholen lässt. Der Four-Wide auf der Döttinger Höhe an der Stelle, wo Uli Richter ums Leben gekommen ist, wurde nicht einmal an die Sportkommissare weitergeleitet.
Und Robert Kubica erhielt 30 Sekunden Strafe für eine Aktion, die selbst in jüngerer Vergangenheit noch Fahrer das Leben hätten kosten können. Das überhaupt sich in einem 24-Stunden-Rennen zwei Fahrer nach gerade einmal einem Viertel Renndistanz gegenseitig so provozieren, dass es dermaßen eskaliert, darf eigentlich gar nicht passieren.
24h Nürburgring 2022: Kollision unter Brüdern reißt "Grello" aus dem Rennen
Dries und Laurens Vanthoor kollidieren bei den 24 Stunden vom Nürburgring 2022, was sich in einem heftigen Unfall des Manthey-Porsches #1 "Grello" manifestiert
Auf Herstellerseite das gleiche Bild. Der einzige Hersteller, der konsequent durchgegriffen hat, war Hyundai mit der Entlassung von Peter Terting nach der Eskapade mit Gülden. Andere Werksfahrer kommen mit teils groben Fahrlässigkeiten ungeschoren davon - Hersteller nehmen lieber solche Aktionen in Kauf, als einen Fahrer mit minimal langsameren Grundspeed heranziehen zu müssen, um eine Dummheit des Primärfahrers zu sanktionieren.
Wenn die Hersteller solches Verhalten nicht sanktionieren, müssen es die Offiziellen tun. Denn die Situation ist brandgefährlich. Wird weiterhin so reingehalten, wird früher oder später etwas Schlimmes passieren.
Die Sicherheit im Motorsport ist extrem hoch - niemand betätigt heute mehr die Türschnalle eines Rennwagen mit dem Gedanken, dass er diesen nicht mehr lebendig verlassen könnte. Das erhöht die Risikobereitschaft extrem. Natürlich können wir das Rad der Zeit nicht zurückdrehen - und das möchte auch niemand.
Es wäre auch gar nicht nötig, denn das Publikum des Social-Media-Infinite-Scrolling-Zeitalters braucht die Adrenalinschübe in viel höheren Dosen. Die Bereitschaft, über Stunden die langsame Entwicklung eines Langstreckenrennens zu genießen, ist im Zuge der stets greifbaren Smartphone-Ablenkung stark gesunken.
Doch früher oder später kommt es zu einem "freak accident" - vielleicht ein ganz ungünstiger Winkel, der beim Crashtest nicht berücksichtigt wurde, ein Hindernis, das so niemand auf der Rechnung hatte, oder einfach eine Verkettung unglücklicher Umstände, wenn ein Auto durch die Luft gewirbelt wird, dass sich ein rumfliegendes Teil in den Körper des Fahrers bohrt. Und momentan tut der Langstreckensport alles, einen solchen heraufzubeschwören.
Die Sanktionen für fahrlässige Manöver auf der Strecke müssen härter werden. Und es gilt, seitens Herstellern, Teams und Motorsportverbänden, bei den Fahrern wieder ein Bewusstsein für die Risiken dieses Sports zu schaffen. Und dass Zurückstecken bei 20 Stunden Restzeit selbst im modernen Langstreckensport vielleicht manchmal die clevere Variante ist.
Euer















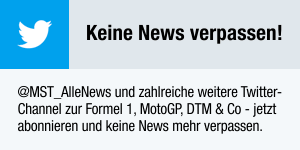

Neueste Kommentare